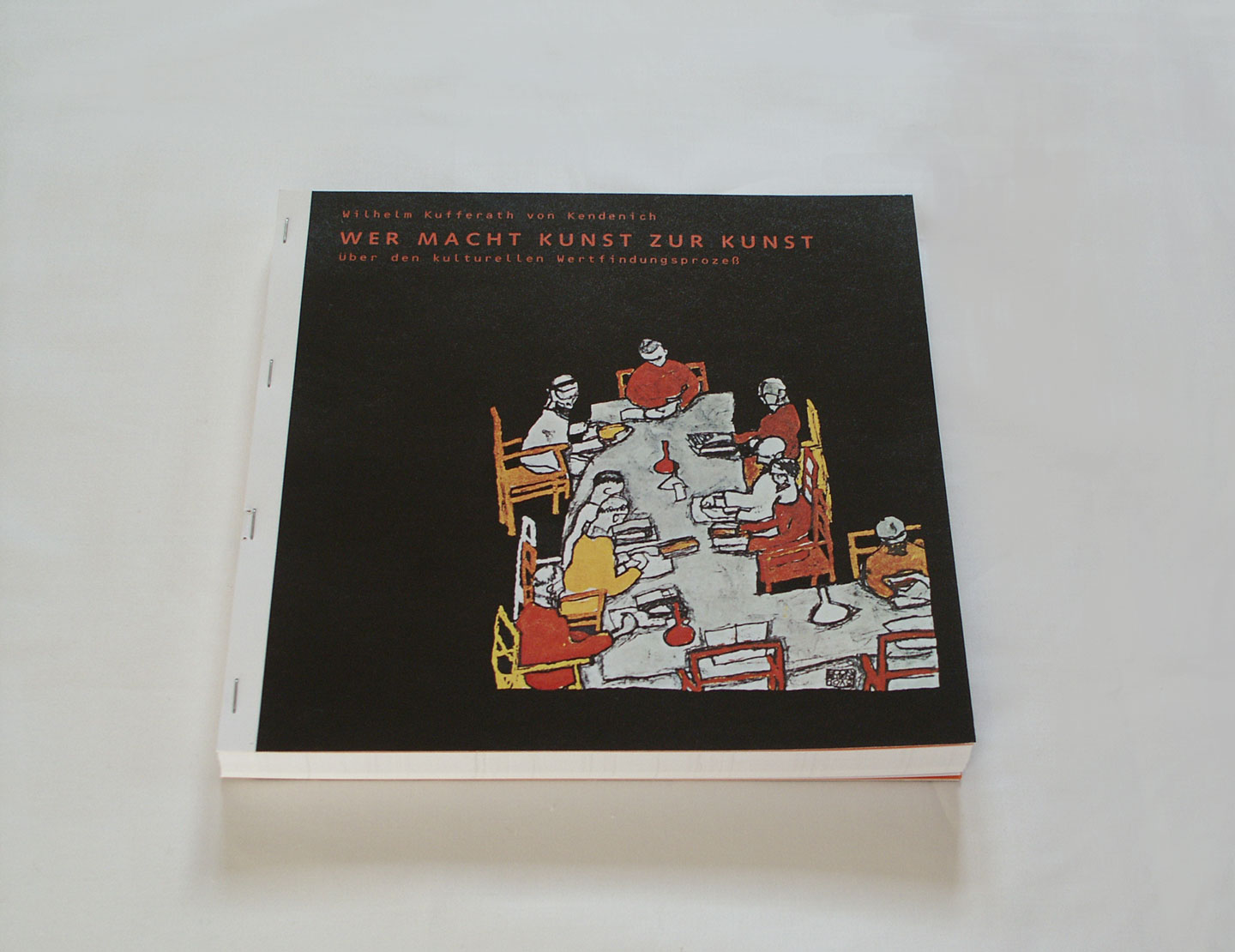Project Description
Wer macht Kunst zur Kunst?
Eine didaktisch übersichtlich aufbereitete Darlegung der sachlichen Kriterien und der gesellschaftlichen Mechanismen, die zur Verleihung des Werturteils Kunst durch die Gesellschaft bzw. ihre Repräsentanten führen, abgeleitet aus dem Vergleich der kulturellen Evolution mit der biologischen Evolution
Wegen seiner Übersichtlichkeit besonders für Lehr- und Studienzwecke geeignet
172 Seiten, 8 schematische Darstellungen, 4 s/w Abbildungen, Halbleinen, 29,7 cm x 21 cm,
ISBN-Nr. 3-907048-14-8
Preis SFR 35,- € 23,-
plus Verpackung und Versand
Inhalt
Der Autor setzt sich mit der biologischen Evolution auseinander, die für die Weiterentwicklung der Arten ein Instrumentarium entwickelt hat, das auf einem dualen Prinzip beruht. Dieses Prinzip besteht immer aus einem sogenannten Macher und einem dazugehörigen Bewerter. Der Macher (in der biologischen Evolution der Mutator) erzeugt mit Hilfe der entsprechenden Fähigkeit (Mutabilität) nach dem Gesetz des reinen Zufalls eine Veränderung (Mutation), der Bewerter (Selektion) bewertet die Veränderung und fällt ein Urteil (Sich-Durchsetzen oder Untergehen der Veränderung) über sie in Bezug auf einen Arten-Vorteil/-Nachteil im gegebenen Umfeld. Nur durch das duale Zusammenwirken von Macher und Bewerter kann eine Veränderung zu Stande kommen. Es lässt sich zeigen, dass es in der Entwicklung der Kultur der menschlichen Spezies eine parallele Entwicklung gibt, die sogenannte kulturelle Evolution. Sie beruht auf der Fähigkeit zur Kreativität (in der biologische Evolution = Mutabilität) des homo sapiens sapiens, er ist der Macher, genannt Kreator (in der biol. Evol. = Mutator), und erzeugt die Veränderung (in der biol. Evol. = die Mutation), in der kulturellen Evolution als Kreation bezeichnet. Dem Macher gegenüber steht der Bewerter (in der biol. Evol. = Selektion), in der kulturellen Evolution Ästimator genannt, der entscheidet, ob die Kreation von der Gesellschaft, die der Bewerter repräsentiert, auch akzeptiert wird. Also auch hier ein duales Prinzip; es tritt in allen Gebieten der Kultur auf: ebenso in allen Bereichen der Wertvorstellungen, der Geisteswissenschaften, der Naturwissenschaften, der Technik wie in der Kunst. In jedem Tätigkeitsbereich, in welchem etwas kreiert, erzeugt, geschaffen wird, ist das duale Prinzip etabliert. Es organisiert sich in einer freien Gesellschaft in dem geistig/institutionellen Rahmen von Domäne und Kampagne. Die Domäne ist die geistige oder auch wirklich institutionalisierte Zusammenfassung aller in einem bestimmten Bereich der Kultur agierenden Macher, also die Gruppe der Produzierenden (materiell und geistig), Mutatoren, Kreatoren. Die Kampagne steht der Domäne gegenüber und ist die Zusammenfassung aller in dem bestimmten Bereich der Kultur agierenden Bewerter, also die Gruppe der Beurteiler, Selektoren, Ästimatoren. Das hat die biologische Evolution die Menschen gelehrt, dass in einem funktionierenden System von Entwicklung die bewertenden Ästimatoren als die Controller im System immer getrennt, selbstständig und vor allem unabhängig von den Produzierenden als Veränderer sein müssen. Dies gilt für die demokratischen Organisationen, für die Politik, die Justiz, für die Wirtschaft, die Industrie, für den Sport und eben auch für die Kunst. Der Autor zeigt diese Zusammenhänge im Einzelnen und führt dazu auch entsprechende philosophische Überlegungen über die Wertesysteme aus. Eingehend behandelt er dann die Etablierung des dualen Prinzips als Duo von Domäne und Kampagne in der Wissenschaft und dann noch umfassender für das Gebiet der Kunst, dem eigentlichen Anliegen des Autors. Die einzelnen Domänen entwickeln ständig ihre Methoden, Regeln, Usancen, Arbeitsweisen, ebenso die Kampagnen, die ihre Bewertungsmaßstäbe, -usancen, -richtlinien, -methoden, -denkungsweisen etc. aufbauen, laufend anpassenund weiterentwickeln. Während sich die Regeln der Domänen und Unterdomänen im allgemeinen leichter fassen lassen, kann dies für die zugehörigen Kampagnen sehr schwierig sein. In der Kampagne Sport, Unterkampagne 100 Meter-Lauf, ist die Bewertung sehr einfach, ein Messgerät bestimmt die Leistung, danach erfolgt die Reihung der Leistung in der Klassifizierung; anders bei der Kampagne Eiskunstlaufen, Unterdomäne Kür Eistanzen, hier ist die Leistung nicht mehr messtechnisch erfassbar, sondern muss durch ein persönliches und damit subjektives Urteil bewertet werden, in solchen Fällen tritt ein demokratisches Mehrheitsurteil an die Stelle des Messwertes. Dann beleuchtet der Autor die Domäne der Kunstschaffenden (das sind die einzelnen Kunstdisziplinen) im Bereich der bildenden Kunst, sehr genau die Domäne der Kunstphilosophen (die sich mit der inhaltlichen Eingrenzung des Begriffes Kunst auseinandersetzen) und die Kampagne des Kunstschaffens (in welcher die Ästimatoren die Bewertung der von der Domäne Kunstschaffen produzierten Arbeiten vornehmen). Die Spezialisten in der Domäne Kunstphilosophie, zu denen auch der Autor gerechnet werden muss, suchen nach einer inhaltlichen Definition des Begriffes Kunst. Hier wird ausgeführt, dass Kunst eine oder vielleicht auch mehrere Eigenschaften beschreibt, die alle Werke der bildenden Kunst, nicht aber die Werke der Nichtkunst besitzen. In spannender Form nimmt der Autor den Leser mit auf die Reise, diesen Unterschied zu suchen und dann zu beschreiben. Dies ist das eigentliche Zentrum des Buches. Hier ist die Antwort auf die Frage zu finden, was ist Kunst und was ist die Qualität der Kunst. Nun ist es aber keineswegs so, dass die Gesellschaft, vertreten durch die einzelnen Kampagnen, das für Kunst halten muss, was die Domäne Kunstphilosophie als Kunst definiert und was die Domäne Kunstschaffen dafür ausgibt: das, was Kunst ist, muß nicht von der Gesellschaft für Kunst gehalten werden, und das, was Nichtkunst ist, kann die Gesellschaft dennoch als Kunst erachten. In allen Einzelheiten wird geschildert, dass ein Werk mit dem Begriff Kunst zu belegen eine Wertzuordnung ist, im Einzelnen zeichnet der Autor die Wege und institutionellen Einrichtungen nach, und lässt so deutlich werden, wie und durch wen das Werk zum Kunstwerk wird. Es ist ein vielschichtiger Prozess, entgegen allen Beschimpfungen ein äußerst demokratischer Prozess, an welchem sich jeder beteiligen darf, ein Prozess, dessen Urteil jederzeit aufgehoben oder abgeändert werden kann, historische Bespiele werden beschrieben. Die Kriterien, die in der Kampagne von den Bewertern angewendet werden, um Kunst und ihre Qualität zu erkennen, werden im Einzelnen dargelegt und ausführlich erläutert. Auch die Zusammensetzung der Kampagne zur Bewertung der Kunst wird in allen Verästelungen diskutiert. Und am Ende steht die Antwort auf die Frage: Was ist Kunst? und Wer macht Kunst zur Kunst? Der Autor zeichnet den Weg, wie in einer freien Gesellschaft ein Werk zur Kunst erhoben wird, weist nach, dass es sich um einen demokratischen Prozess mit einer statistischen und stets schwankenden Realität als Ergebnis dieses Prozesses handelt, dessen Urteil jederzeit wieder verändert werden kann. Erst über Generationen festigt sich das Urteil, dass dies oder jenes Werk Kunst ist, aber auch nach Generationen noch kann dieses Urteil, wie die Kunstgeschichte zeigt, wieder aufgehoben werden.
Buchaufbau
Das Buch ist didaktisch sehr übersichtlich und einprägsam aufgebaut. Es besteht aus einem Fachteil in Form einer breiten Buchspalte und einem Stichwortteil in Form einer zweiten, einer schmalen Spalte, in der neben jedem Textabsatz ein die Orientierung sehr erleichterndes Schlüsselwort zu finden ist. Immer wieder werden resümierende Schlüsselsätze zu kurzen Absätzen gefasst und zum schnellen Aufgreifen kursiv abgesetzt. Wichtige Feststellungen werden als kurze, prägnante Merksätze selbstständig im zugehörigen Textbereich auf einer ganzen Seite in großen, eingehenden Lettern freigestellt. Eingängige Abbildungen erläutern die Zusammenhänge. Als Besonderheit hat der Autor einige in sich geschlossene, ganz selbstständige Kurzgeschichten eingestreut, die immer in engem Zusammenhang mit den Aussagen im betreffenden Fachtextbereich stehen, Geschichten, die spielerisch, manchmal fast märchenhaft den gedanklichen Faden aufnehmen. So wird dieses Fachbuch zu einer erlebnisreichen Lektüre für den Schnell-Leser, den Leicht-Leser und den Tief-Leser. Es eignet sich in besonderem Maße für alle Lehr- und Studienzwecke, weil der oft schwierige philosophische Hintergrund leicht verständlich und übersichtlich aufbereitet ist. Und der Laie wird darin eine Türe finden, die ihm den Weg zur Kunst aus einer neuen Sicht öffnet.
Keywords
- Biologische Evolution (biological evolution)
- kulturelle Evolution (cultural evolution)
- strenge Parallelität zwischen biologischer und kultureller Evolution (parallelism between biological and cultural evolution)
- Mutabilität, Mutator, Mutation (mutability, mutator, mutation)
- Kreativität, Kreator, Kreation (creativity, creator, creation)
- das duale Prinzip in jeder wirklichen Evolution (the dual principle in every genuine evolution)
- Organisation des dualen Prinzips in Domäne und Kampagne (the organization of the dual principle in domain and campaign)
- Philosophie der ethischen Werte (philosophy of ethical values)
- Domäne und Kampagne in der Wissenschaft und in der Kunst (domaine and campaigne in science and art)
- Methodologie der Kunst (methodology of art)
- Definition des Begriffes Kunst (definition of the conception of art)
- Kunst als Wertbeimessung (art as attribution of value)
- Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst (difference between art and non-art)
- Mechanismen der Ernennung eines Werkes zum Kunstwerk (mechanisms of claiming a work for art)
- Institutionen, Organisationen und Personen, welche ein Werk zum Kunstwerk erheben (institutions, organizations and persons who claim a work for art)
- Kunst und Qualität (art and quality)
- Kriterien für die Erhebung eines Werkes zur Kunst (criterions for the acceptance of a work as art)
- schwankende statistische Realität der Kunst (shilly shally statistical reality of art)
Textprobe
Die Kreation ist mithin für die kulturelle Evolution das Gegenstück zur Mutation für die biologische Evolution. Eine Mutation ist nur dann relevant, wenn sie sich in der Selektion durch die Umfeldbedingungen auch bewährt. Mutationen, welche diese Bewährung nicht bestehen, können sich nicht durchsetzen und gehen unter. Konsequenterweise wird nur das als Mutation gezählt, was sich durchgesetzt hat. Ganz analog wird nur das als Kreation im Sinne der kulturellen Evolution bezeichnet, was sich durchsetzt, d.h. was von den Menschen angenommen wird. Kreativität ist nur gegeben, solange die Kreation von den Menschen angenommen bleibt und existiert. Verschwindet die Kreation, aus welchem Grund auch immer, dann kann auch nicht mehr von Kreativität gesprochen werden. Kreation und Kreativität sind also an ihren Erfolg gebunden. In diesem Sinne gibt es Kreativität nicht oder nicht mehr, wenn die Kreation sich nicht oder nicht mehr behaupten kann. Das ist ein ganz wesentlicher Zusammenhang. Er besagt, daß ein Mensch nur dann und nur für die Zeitspanne als kreativ zu gelten hat, als seine Kreation von einem bedeutenden Teil der Menschen anerkannt oder gebraucht wird bzw. solange sie anerkannt ist oder gebraucht wird. Die Zuordnung der Kreativität zu einer Person steht in Abhängigkeit des Erfolges ihrer Kreation. Das ist der entscheidende Umstand. Und er läuft wieder parallel zur sprachlichen Handhabung in der biologischen Evolution. Das duale Prinzip von Mutation und Selektion, dieses göttliche Paar der biologischen Evolution, ist auch das Grundprinzip der kulturellen Evolution. Auf der einen Seite stehen die Kreatoren: die Erschaffer, die Veränderer, die Schöpfer, die Erfinder, die creatores homines, Menschen, natürlich, und auf der anderen Seite finden sich die Ästimatoren: die Beurteiler, die Juroren, die Bewerter, die Verwerter, die Anwender, die aestimatores homines, Menschen, natürlich. Systemisch oder funktionell ausgedrückt: auf der einen Seite das producing, auf der anderen Seite das controlling. ‘Macher’ treten als Erfinder, als Produzenten usw. auf, und Bewerter als Verwerter, Verbraucher usw. Verwerten und Anwenden ist zugleich immer auch ein Bewerten. ** Es ist schwer, ich sage es noch einmal, das Wesen der Kunst als das Aus-Freiheit-zweckfrei-Geschaffene zu begreifen, denn alle uns angelernten Begriffe, mit denen wir der Kunst in betrachtender, interpretierender und auf diese Weise verstehender Absicht zu Leibe rücken, kommen in dem dargelegten Wesensverständnis nicht (mehr) vor: Schönheit, Ästhetik, Ausdruck, Wirkung, Unmittelbarkeit, Originalität, Innovation, Gefallen, handwerkliches Können, Gebundenheit an bestimmte ‘kunstwürdige’ Materialien, Avantgardismus, Provokantismus, Pflicht, Zielsetzung, gesellschaftskritische Positionsergreifung und Verpflichtung, Besetzung politischer Positionen, Kampf für oder gegen irgend etwas, Zwang zur Legitimation, nein, nein, nichts von alle dem, frei von alle dem, eleuteral, frei von allen Fesseln des Müssens, im wahrsten Sinne des Wortes und im weitesten Sinne des Wortes frei, frei bis tief hinunter auf den Urgrund der Seele. Das ist Kunst, und das ist ihre Freiheit, von der so viel geredet, die aber nicht wirklich ernst genommen wird. Kunst ist autonom. Sie ist da. Das ist ihr Selbstverständnis. Daß sie da ist, ist ihre Daseinsberechtigung. Aus. Nicht mehr, nicht weniger. Kunst verdankt ihr Dasein dem evolutionären Geschenk Kreativität. Und Kreativität braucht keine Begründung. Sie ist gegeben wie unsere anderen Fähigkeiten auch.