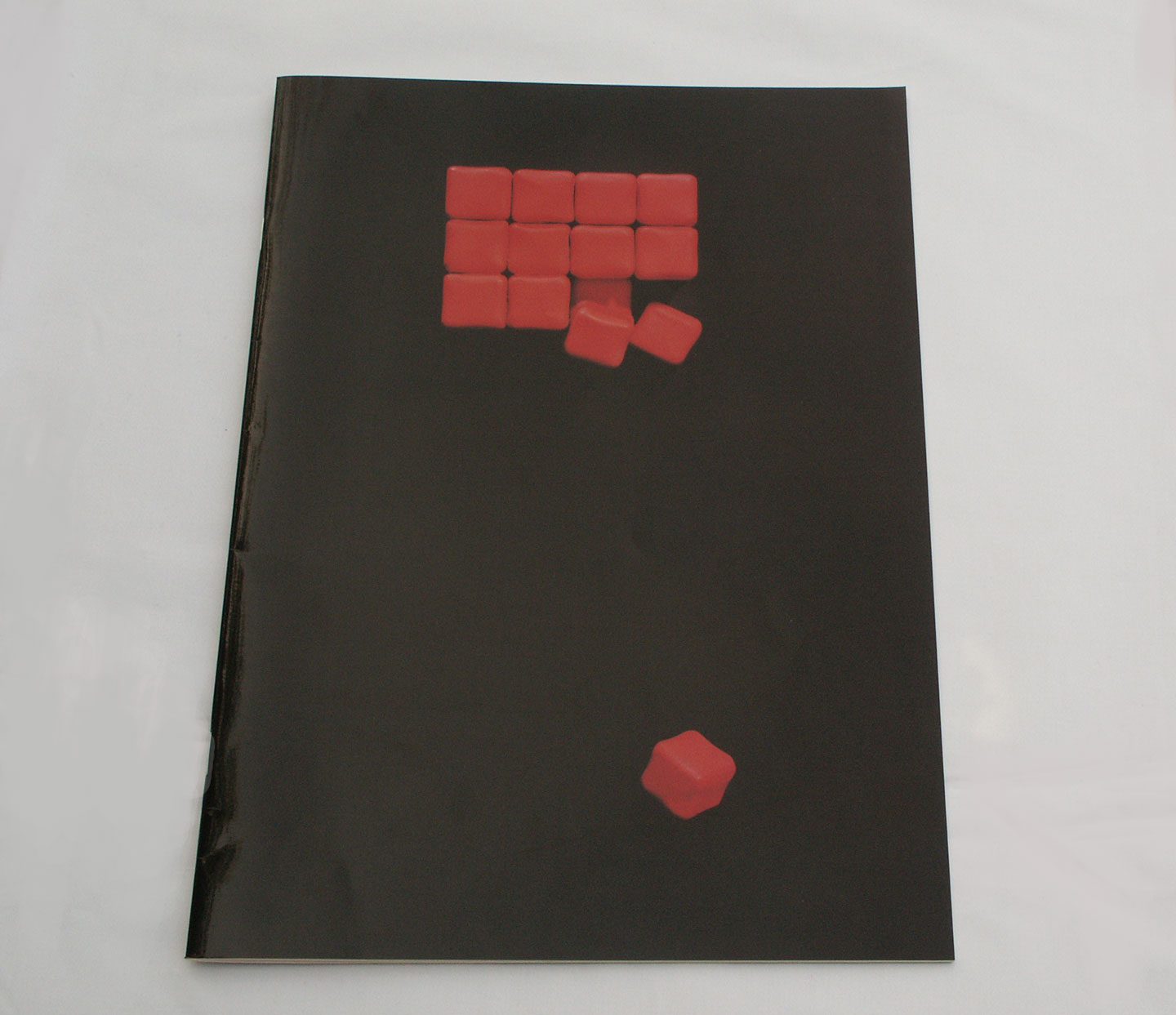Project Description
Vom assoziativen Kunsterleben
Diese kunsttheoretische Arbeit befasst sich mit den visuellen Interpretationsgewohnheiten der Kunstbetrachter und erläutert diese an vielen einfachsten Schwarzweißdarstellungen. Sie beschreibt damit die emotionalen Vorgänge, wie sie im Betrachter während des Betrachtungsvorganges ablaufen. Eingearbeitet in den Text sind zu den Schwarzweißzeichnungen farbige fotografische Wiedergaben einer Anzahl von Bildobjekten und Skulpturen aus dem Atelier des Autors, der zugleich auch Künstler ist.
Bestens geeignet für den Lehr- und Studienunterricht auf den verschiedenen Ausbildungsstufen, auch für den Selbstunterricht und die autodidaktische Weiterbildung äußerst hilfreich
20 Seiten, 17 Text erklärende Schwarzweißdarstellungen, 7 farbige Abbildungen, hochglanz-kartoniert, 29,7 cm x 21 cm
Preis: SFR 25,- € 16,-
plus Verpackung und Versand
Inhalt
Es werden die Vorgaben beschrieben, die der Mensch in sich zur visuellen Wahrnehmung vorfindet. Das visuell mit den Augen Aufgenommene wird als Reizinformationen über Nerven zum Gehirn transportiert und dort den bereits vorhanden Informationen zugefügt. In diesem Zufügungsvorgang werden die Informationen mit den früheren sofort verglichen, wodurch die alten Erfahrungsinhalte angestoßen und amplifiziert werden und als Assozationen ins Bewußtsein treten.Auf diese Weise erhalten die neuen visuellen Botschaften individuelle und subjektive emotionsauslösende Fähigkeiten. Der Autor beschreibt an vielen Beispielen, wie diese Vorgänge ablaufen und wie es zu emotionalen Wirkungen im Betrachter kommt. Da Künstler denselben Wahrnehmungsmechanismen unterliegen, setzen sie unbewußt diese Mechanismen zur Schaffung ihrer Kunst ein. Wenn sich die Assoziationsketten, die sich im Künstler bei der Realisierung seines Werkes eingestellt haben, nicht in ähnlicher Weise im Betrachter bilden können, wird dieser das Bild ‚nicht verstehen‘ und ablehnen.
Keywords
- Angeborene Vorgaben zur Wahrnehmungsverarbeitung (inborn abilities for perception)
- Erworbene Vorgaben zur Wahrnehmungsverarbeitung (acquired abilities for perception)
- Vom Wahrnehmen zum Erleben (perception and emotional experience)
- Assoziationsmethode als Vorgabe (the methode of association)
- Eingrenzung des Begriffes Kunst (definition of art)
- Subjektives Sehen (subjective seeing)
- Visuelle Wahrnehmung als Absonderung und Hervorhebung (visual perception as a process of separating and of giving prominence)
- Verknüpfungen des Abgesonderten mit dem Behaupteten (connecting separated contents
- with such to which prominence was given)
- Hinzufügen früherer Erkenntnisinhalte zum neuen Wahrnehmungsinhalt (addition of earlier contents of perception to the new ones)
- Nutzung der Assoziationsvorgänge in der visuellen Gestaltung (using association processes for visual art)
- Interpretationsschwierigkeiten des Betrachters (beholder’s difficulties with interpretation )
- Forderung nach einem Titel für das Werk (request of beholders for a title of an art work)
- Kunst als Träger einer Botschaft (art as vehicle of message)
- Von der Beglückung im Kunsterleben (about bliss in art experience)
Textprobe
Der Vorgang des Wahrnehmens läuft immer in zwei verschiedenen, eigentlich entgegengesetzten Richtungen: er sondert ab und setzt durch. Das Als-allgemein-Genommene, dem das Interesse nicht zugewandt ist oder nicht zugewandt werden soll, wird abgeschieden und zurückgedrängt in einen unscharfen Hintergrund. Das für des Betrachters Interesse Geöffnete trennt sich als Folge der Absonderung des Allgemeinen heraus und tritt scharf gezeichnet in den Vordergrund, und alle seine zugehörigen Elemente behaupten »einen bestimmten, prävalenten Wahrnehmungskonnex. Wenn wir eine Figur von einem Grund, einen Körper von seinem Umraum, ein A von einem Nicht-A abheben, zeichnen wir aus und entscheiden uns für die begrenzte gegen die potentiell unbegrenzte Ausdehnung, für eine bestimmte Gestalt gegen ein unbestimmtes Feld« (Werner Hofmann). Ganz typisches Beispiel dieser kollektiven Vorgabehaltung in uns: Haben Sie im Museum schon einmal bewußt den Rahmen eines Sie sehr beeindruckenden Bildes gesehen? Wie ist Rembrandts uns allen bekanntes Bild Der Mann mit dem Goldhelm (um 1650; Berlin-Dahlem) gerahmt? Wir wissen es nicht, weil wir im Betrachten den Rahmen abgetrennt und in den verschwommenen Hintergrund der Museumswand verdrängt haben, über deren Wesensart wir zumeist ebenfalls nichts mitbekommen. Doch dieses in einen unscharfen Nebel Abgesonderte ruht dort nicht, sondern es sendet unbemerkt weiterhin Signale an uns aus, die wir ganz unbewußt, gewohnheitsmäßig, aufnehmen und in Bezug zum Ausgewählten unserer Betrachtung setzen und wirken lassen.